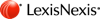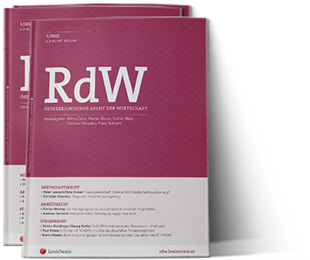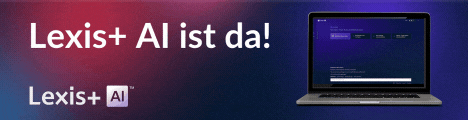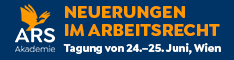-

- » Die Zeitschrift
- Über die RdW
- Über die RdW digital
- Herausgeber
- Für Autoren
- Abonnement
- Jahres-Abonnement
- Testen
- Abo freischalten
- Mediadaten
- Kontakt
- alle Zeitschriften
- » Extras
- Aktuell
- Datenschutz in der COVID-Krise – Podcast
- Guideline Vergabeverfahren
- Werte
- Vergleichstabelle zum WTBG 2017
- Webinare
- Webinare - Übersicht
- Vorschau
- Gesetzesvorhaben
- EuGH
- Wissen
- Spezielles
- Jahresinhaltsverzeichnisse
X